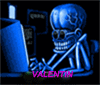Der Heilige Abend am 24. Dezember, auch Heiligabend genannt, ist der Vorabend des Weihnachtsfestes. An diesem Abend findet unter anderem in Deutschland, der Schweiz, in Liechtenstein und in Österreich traditionell die Bescherung statt. Der 24. Dezember ist in diesen Staaten kein gesetzlicher Feiertag im Sinne der Arbeitsruhe. In den meisten Landesgesetzen ist er ab den Nachmittags- oder Abendstunden als stiller Tag festgesetzt.
Als Heilige Nacht wird die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bezeichnet. Allgemeines
„Julaftonen" (Der Heilige Abend) (1904–1905), Aquarell von Carl Larsson
Nach dem antiken Kalender endete der Tag mit dem Sonnenuntergang,
somit gehörte der Abend des 24. Dezember liturgisch bereits zum
Weihnachtstag. In Europa hat sich die familiäre Weihnachtsfeier mit
Bescherung und Festessen mehr und mehr auf den Abend oder schon den
Nachmittag des 24. vorverlagert. Neben den deutschsprachigen Ländern
findet die Bescherung unter anderem auch in Argentinien, Polen, Portugal, Ungarn und den nordischen Ländern
am Heiligabend statt. In den meisten anderen, vor allem den
englischsprachigen Ländern, werden die Geschenke am ersten Weihnachtstag
verteilt.
Das Fest wird meist im engsten Familienkreis gefeiert. Zuerst folgt die Bescherung
und danach das Essen zum Heiligen Abend, das regional unterschiedlich
begangen wird. In Deutschland ist es verbreitet, Kartoffelsalat mit
Würstchen oder eine ähnlich einfache Mahlzeit zu essen, aber auch
aufwendige Gerichte wie Gans oder Karpfen sind üblich. In vielen Familien gehört der Besuch eines Gottesdienstes, entweder am späten Nachmittag (Christvesper, Krippenspiel) oder nachts (Christmette),
zum gewohnten Ritual, auch bei Nicht-Kirchgängern. Die Gottesdienste am
Heiligen Abend sind daher in allen christlichen Konfessionen die am
besten besuchten im ganzen Jahr.
Liturgie
Im liturgischen Kalender ist dem 24. Dezember das Gedächtnis Adams und Evas zugeordnet. Mit der ersten Vesper von Weihnachten beginnt die Weihnachtszeit. Die morgendlichen Stundengebetszeiten und Gottesdienste sind die letzten der Adventszeit, und der Tag gilt bis zur nächtlichen Weihnachtsmesse (Mette) als Fasttag.
Örtlich wurde die Gottesdienstzeit von Mitternacht immer weiter in
die Abendstunden vorgezogen. Bei Sonnenuntergang am späten Nachmittag
finden vielerorts bereits „Kinderchristmetten" und „Krippenspiele"
statt. Die Christmette soll den erneuerten liturgischen Vorschriften der katholischen Kirche jedoch in der Nacht stattfinden, da es sich um eine Nachtwache handelt.[1]
Sonstiges
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 brannten in vielen Fenstern in der Bundesrepublik Deutschland zu Heiligabend Kerzen. Mit dieser Geste, die auf den damaligen Berliner Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter
zurückgeht, wurde der Kriegsgefangenen gedacht, die nach Kriegsende
noch nicht heimgekehrt waren. Bis in die 1960er Jahre wurden derartige
Kerzen anlässlich der deutschen Teilung als Solidaritätsbekundung mit
den „Brüdern und Schwestern im Osten" aufgestellt.[2]
Der Brauch, am Heiligen Abend eine brennende Kerze ins Fenster zu
stellen, wird seit 1986 wieder gepflegt. In Rom erscheint der Papst um
18 Uhr am Fenster seiner Privatgemächer und entzündet eine Kerze mit dem
„Lumen de la Pace"
(Licht des Friedens), das in der Vorweihnachtszeit von Pfadfindern in
der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet worden ist, und in
Laternen weitergegeben wird, um es in der Heiligen Nacht in den
Fenstern leuchten zu lassen.
| 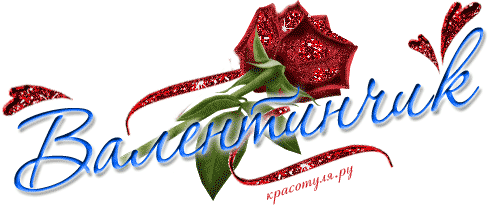 Valentin
Valentin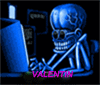
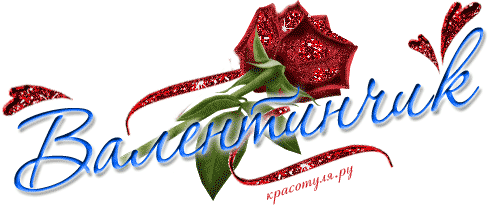 Valentin
Valentin